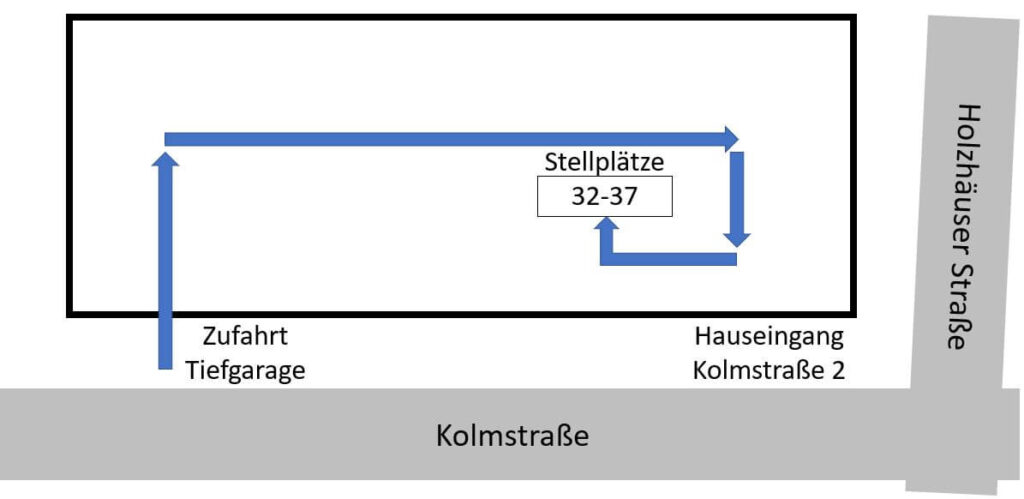Unser Kreuzband-Konzept
Gründe, die für eine OP sprechen, sind die nicht kompensierbare Instabilität, Begleitschäden und vermehrte körperliche Belastung in Sport und Beruf.
Unter Einbeziehung von Aktivitätslevel, persönlichem Anspruch und Patientenalter erfolgt die Transplantatwahl und die Wahl der Fixierungsmethode.
Als Transplantate kommen die Semitendinosus-, Quadrizeps-, Peroneal- und Patellarsehne in Betracht. Die Fixierung erfolgt mit Interferenzschrauben oder Ankersystemen.
Sehr häufig kommt es bei Kreuzbandrissen zu Begleitverletzungen an den Menisken, deren operative Versorgung idealer Weise mit dem Kreuzbandersatz in einer OP simultan erfolgen sollte. Diese frischen Meniskusrisse sind oft für eine Meniskuserhaltung (Naht) geeignet. Außerdem führt die Kniestabilisierung durch den Kreuzbandersatz zur Vermeidung einer atypischen Meniskus- und Knorpelbelastung, was die Heilungschancen für den genähten Meniskus zusätzlich verbessert. Bei den simultanen Operationen von Kreuzband und Meniskus entfällt letztendlich auch ein zweiter operativer Eingriff mit erneut langwieriger Nachbehandlung.
Andererseits läßt sich mit dem Kreuzbandersatz leider nicht zwangsläufig eine spätere Arthrose vermeiden. Der Vorteil der Kreuzband-OP liegt in der zumeist wiedererlangten Sportfähigkeit und der größeren Belastbarkeit des Kniegelenkes.
Lokale Knorpelschäden am Knie
Knorpelzell-Transplantation (M-ACT)
Auch die Knorpelzell-Transplantation kann meist minimalinvasiv oder mit einer Kniespiegelung (Arthroskopie) durchgeführt werden. Es sind zwei Eingriffe nötig. Beim ersten Eingriff wird eine Gewebeprobe entnommen – ein kleines Stück Knorpel – und außerdem patienteneigenes Blut. Anschließend werden aus dem entnommenen Knorpel die Knorpelzellen isoliert. Diese Knorpelzellen werden mittels eines speziellen Laborverfahrens dazu gebracht, sich über die nächsten 6 – 8 Wochen im Labor in dem entnommenen Blut zu vermehren. Nach ca. 1,5–2 Monaten werden die kultivierten Knorpelzellen in den zuvor entsprechend vorbereiteten Knorpeldefekt eingebracht und wachsen dort an. Nach und nach bildet sich allmählich neuer, hyalin-ähnlicher Knorpel, der fast genauso belastbar ist wie das ursprüngliche Gewebe. Für die Transplantation ist ein zweiter Eingriff nötig, der aber ebenfalls meist minimalinvasiv mit einer Arthroskopie durchgeführt werden kann.
Der Vorteil dieses Verfahren ist, dass auch großflächigere Schädigungen (bis 10 cm²) damit behandelt werden können. Zudem gibt es kaum Gefahr der Abstoßung, da die Zellen körpereigen sind und im eigenen Blut kultiviert werden. Es entsteht gut belastbarer, hyalin-ähnlicher Knorpel. Damit der Knorpel richtig aushärten kann und die volle Funktionsfähigkeit besitzt, braucht es eine relativ lange Rehabilitationszeit. Nach ca. 6 Wochen wird das Knie allmählich wieder mit Hilfe von Unterarmgehstützen an die Belastung gewöhnt. Nach ca. 3 Monaten können Alltagsaktivitäten in der Regel vollumfänglich wahrgenommen werden, Kontaktsportarten (Fußball, Handball etc.) sollten allerdings erst wieder ein Jahr nach Behandlung aufgenommen werden.
Für mehr Informationen zum Thema moderne Knorpeltherapie empfehlen wir die Internetseite www.knorpelexperte.de.
Achsfehlstellung der Beine
Eine Umstellungsosteotomie kann den Knochen wieder gerade richten, die Fehlstellung beseitigen und somit auch die Beschwerden des Patienten lindern.
Von Patienten und Ärzten wird zunehmend der Erhalt des eigenen Gelenkes und die Vermeidung einer Endoprothese als wichtiges Ziel gesehen.
Der Begriff Osteotomie beschreibt die operative Durchtrennung eines Knochens. Nach der Durchtrennung des Knochens (Osteotomie) soll der Knochen in einer korrigierten Form verheilen. Am häufigsten werden Umstellungsosteotomien nahe des Kniegelenkes am Schienbein (Tibia), am Oberschenkel (Femur) oder in Kombination von beiden durchgeführt. Die neuen, winkelstabilen Plattensysteme bieten eine so hohe Stabilität im Bereich der Osteotomie, dass eine sichere Knochenheilung in relativ kurzer Zeit ohne Korrekturverlust nahezu garantiert ist.
Meniskusriss
Symptome
Meniskusrisse können unfallbedingt und verschleißbedingt auftreten und verschiedene Risstypen und Ausprägungen aufweisen. Daraus kann sich die unterschiedliche Intensität von Belastungs- und Rotationsschmerz, Blockierung und Reizerguss ergeben. Sekundär, d. h. als Folgeerkrankung, können Meniskusschäden zu Meniskusganglien, Kniekehlenzysten (Bakerzysten) und Knorpelschäden führen. Neben Alterungsprozessen und Alltagsbelastungen spielen dabei Risikofaktoren wie eine Fehlstellung der Beinachse (O-Bein, X-Bein) oder kniebelastende Sportarten und Berufe eine besondere Rolle.
Diagnostik
Die Diagnostik erfolgt durch klinische Tests (Überbeugung, Überstreckung, Rotation) und die Lokalisierung von Schmerzpunkten. Im Ultraschall ergeben sich direkte (Rissdarstellung, Deformierung) und indirekte (Erguss) Hinweise auf einen Meniskusriss. Im Röntgenbild ist die knöcherne Gelenkkonstellation ablesbar. Selten markieren Gewebeverdichtung (Sklerosierung) oder Kalkeinlagerung die Menisken. Im MRT lässt sich ein Riss häufig auch in seiner Ausdehnung darstellen.
Therapie
Die Notwendigkeit einer Meniskus-OP ergibt sich aus den individuellen Beschwerden und Begleiterscheinungen sowie den damit verbundenen sportlichen und beruflichen Einschränkungen. Bei anhaltendem Schmerz und eingeschränkter Kniefunktion (Blockierung) ist die arthroskopische OP die hilfreichste Therapie.
Unser absolutes Bestreben gilt der Meniskuserhaltung, da Meniskusverlust wiederum zu Fehlbelastungen im Knie mit sekundärer Arthrose führen kann. So ist beim Einblick ins Gelenk nach dem üblichen „Rundgang“ als erstes zu klären, ob eine Meniskusnaht möglich ist oder ein Teil des Meniskus entfernt werden muss.
Nach einer solchen Meniskus-Teilentfernung kann man bereits nach wenigen Tagen wieder Fahrrad fahren, was einer idealen Knierehabilitation gleichkommt. Das Knie wird dabei kontrolliert bewegt, aber nur wenig belastet. Viel langwieriger ist hingegen die Nachbehandlung bei Meniskusnähten mit einer erforderlichen Schonzeit von mindestens 6 Wochen.
Patellaluxation (Kniescheibenluxation)
Symptome Kniescheibenluxation
Eine Kniescheibenausrenkung (Patellaluxation) ist selten Unfallfolge, sondern wird sehr viel häufiger durch die fehlende Balance zwischen Muskelzugrichtung und knöcherner Führung der Kniescheibe bei zu flachem Kniescheibengleitlager (Trochleadysplasie) verursacht.
Im Moment der Luxation verklemmt sich bei nahezu gestrecktem Knie (Beugung zwischen 0° und 20°) kurzzeitig oder anhaltend die Kniescheibe auf der Knieaußenseite. In der Regel kommt es dabei zu einer Kapselüberdehnung/Kapselzerreißung auf der Knieinnenseite (MPFL) sowie zu einer Knorpelläsion an der äußeren Rolle des Oberschenkelknochens und am inneren Kniescheibenrand. Häufig ist die Notbehandlung mit Kniescheibeneinrenkung erforderlich. Durch die Kapselzerreißung kommt es zu einer Einblutung im Gelenk (Hämarthros), was sich in einer deutlichen Schwellung äußert.
Diagnostik
In der Röntgenuntersuchung stellen sich ggf. knöcherne Verletzungen und ein flach auslaufendes Patellagleitlager (Trochleadysplasie) dar. Das MRT zeigt Kapselzerreißung und Knorpel-Knochen-Schäden.
Therapie
Konservative Therapie: Bei der erstmaligen Luxation ohne abgerissene Knorpel-Knochen-Fragmente (Gelenkkörper) ist es ratsam, im Rahmen einer Physiotherapie die patellastabilisierende Muskulatur zu kräftigen, z. B. mit Hilfe von Gerätetraining, Theraband, Goosesteps oder elektrischer Muskelstimulation. Eine Bandage unterstützt die Kontrolle über die Kniescheibe.
Operative Therapie: Bei wiederholten Luxationen kommen operative stabilisierende Verfahren in Betracht, z. B. die Stabilisierung des Patella-Halteapparates (MPFL-Ersatz) oder eine Änderung der Patella-Zugrichtung (Tuberositasversatz). Bei seltenen Drehfehlern des Oberschenkelknochens ist die Korrektur des knöchernen Drehfehlers zu erwägen. Diese Operationen werden ggf. mit der Vertiefung des Patellagleitlagers (Trochleaplastik) kombiniert.
Kniegelenksarthrose
Symptome
Charakteristisch für eine Arthrose ist der schleichende Beginn über Jahre, da der Knorpelschaden aufgrund fehlender Schmerzrezeptoren nicht wahrgenommen wird und außerdem das geschädigte Gelenk als biologisches System eine sehr hohe Kompensationsfähigkeit besitzt. Dann jedoch reichen geringfügige auslösende Ereignisse, die zu Schmerz, Erguss, Überwärmung und Bewegungseinschränkung führen.
Patienten klagen häufig über Anlauf- und Belastungsschmerz, aber auch über Ruheschmerz bei langem unbequemem Sitzen während Autofahrten oder Flugreisen.
Diagnostik
Die Beurteilung des Arthrose-Stadiums erfolgt am besten durch die Röntgenuntersuchung im Stehen (Rosenberg-Aufnahme), bei der man Hinweise auf die Dicke des noch vorhandenen Knorpels und auf eine knöcherne Deformierung erhält. Eine MRT-Untersuchung ist nur bei gezielter Fragestellung erforderlich, um die Möglichkeit spezieller Behandlungen zu klären.
Therapie
Die Behandlung erfolgt so lange wie möglich konservativ (nicht-operativ). Sie stellt eine Kombination aus Gelenkberuhigung durch Entlastung, Schonung und Kühlung (bei überwärmtem Knie) einerseits und Gelenkmobilisierung mit dehnenden Übungen im Sitzen und Liegen zur Vermeidung der drohenden Einsteifung andererseits dar.
Im Anfangsstadium sind spezielle Schuheinlagen oder Sohlenranderhöhungen durch Entlastung der Beinachse (besonders bei O-Bein und X-Bein) aussichtsreich. Auch ein moderates Training der Beinmuskulatur (immer im Sitzen und Liegen!) hat sich als günstig erwiesen. Durch bewusstes knieschonendes Verhalten und Achtsamkeit zur Vermeidung von störenden Einflüssen kann in der Regel über lange Zeit ein akzeptabler Zustand erhalten werden. Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion, guttuende Einreibungen und Massagen wie auch Hyaluronsäure- und Eigenplasmainjektionen können helfen, operative Maßnahmen hinauszuschieben.
Alters- und befundabhängig sind gelenkerhaltende Operationen mit Korrektur der Beinachse und gelenkersetzende Operationen (Teilersatz, Vollersatz) zu erwägen. Bei der Teilprothese bleiben ca. zwei Drittel des Gelenkes bestehen. Bei desolater Gelenksituation und entsprechendem Leidensdruck stellt die Vollprothese eine Erlösung dar und führt meistens zu einer Verbesserung der Lebensqualität und des Aktivitätslevels.
Freie Gelenkkörper
Symptome
Die Gelenkkörper können zu Einklemmung mit Schmerz und Blockierung oder zu Reizzuständen mit Erguss führen. Die wiederkehrende Einklemmung kann den gesunden Knorpel schädigen.
Diagnostik
Freie Gelenkkörper (Dissekate) sind röntgenologisch gut erkennbar. Oft sind sie größer als im Röntgenbild dargestellt, weil zu dem gut sichtbaren knöchernen Anteil noch die schlecht abgebildeten knorpeligen Anteile hinzukommen.
Therapie
Damit die freien Gelenkkörper den gesunden Knorpel nicht schädigen, sollten sie arthroskopisch entfernt werden. Nach dem Eingriff ist die Gelenkfunktion meist nach ein bis zwei Wochen wieder hergestellt.
Chronische Sehnenschäden
Symptome
Die Patienten schildern typische Schmerzen unter sportlicher Belastung, häufig mit Sehnenreiben und -schnappen.
Diagnostik und Therapie
Eine Änderung von Laufgrund und Schuhwerk, die Verordnung von Hilfsmitteln (Fußbetteinlagen, Tape, Bandage) und die mentale Einstimmung auf einen langwierigen Heilungsverlauf sind erforderlich. Während die Diagnose relativ leicht zu stellen ist und meist keiner bildgebenden Verfahren bedarf, gestaltet sich die Therapie umso langwieriger und komplexer.
Im Vordergrund stehen manuelle Therapie und exzentrisches Training zur Aufdehnung der betroffenen Sehne. Unterstützend erfolgen situationsgerecht Wärmeanwendung, Stoßwellentherapie, Biostimulation etc.
In seltenen Fällen sind Spritzenanwendungen (ACP, Kortison u. a.) erforderlich.
Die operative Entfernung von oft wulstig vernarbtem Gewebe in der Sehnenumgebung und die Nervenunterbrechung zur Schmerzausschaltung (Denervierung) bleiben Ausnahmefällen vorbehalten.
Osteochondrosis dissecans (OD)
Symptome
Die Beschwerden reichen von leichten Belastungsschmerzen bis hin zu schweren Blockierungen bei Einklemmung des herausgelösten Dissekates.
Diagnostik
Im Röntgen und im MRT ist die umschriebene Verknöcherungsstörung stadienabhängig erkennbar. Im Endstadium zeigen sich der herausgelöste Gelenkkörper (Gelenkmaus) und das leere Mausbett.
Therapie
Die Behandlung der Osteochondrosis dissecans erfolgt stadiengerecht mit Sportpause, Entlastung an Gehstützen, Ultraschall und Stoßwelle. Bei weiterem Voranschreiten kann eine retrograde Herdanbohrung vorgenommen werden, um das Dissekat zu revitalisieren und die noch intakte Knorpeldecke zu schonen.
Ist die Knorpeldecke bereits aufgebrochen, erfolgt die Bergung des herausgelösten Gelenkkörpers.
Zur Auffüllung des Defektes ist der Gelenkkörper nur selten geeignet. Alternativen sind die Mikrofrakturierung des Defektgrundes zur Stammzellaktivierung und Bildung von Ersatzknorpel. Weitere Möglichkeiten sind die Auffüllung des Knochendefektes mit Knorpel-Knochen-Zylindern und die Auffüllung mit Knochenmaterial und Abdeckung mit angezüchteten Knorpelzellen (ACT) oder mit einer Kollagenmembran (AMIC).